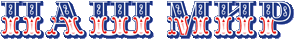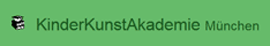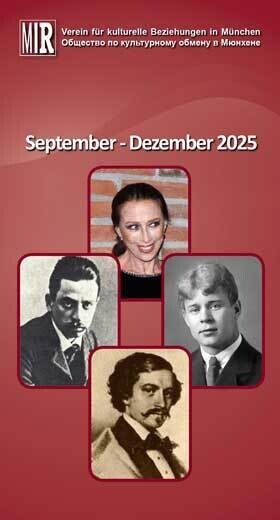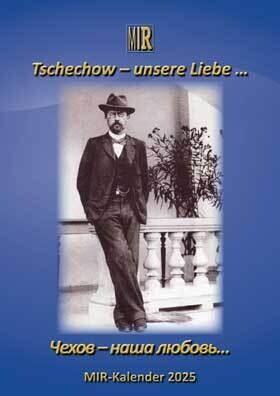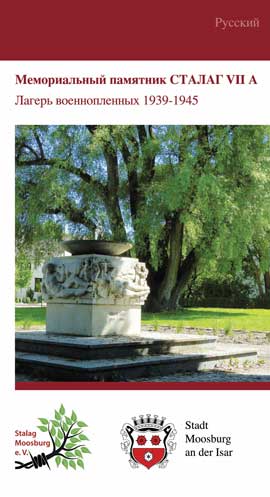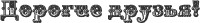
Добро пожаловать в «Наш мир». Здесь вы узнаете как о жизни соотечественников, проживающих в Баварии, так и о жизни наших друзей в других странах.
Internationales Projekt
- Информация о материале
- Опубликовано: 20 ноября 2025
- Обновлено: 20 ноября 2025

Kultur statt Diktatur: Donaujugend im demokratischen Dialog
Unter diesem Titel fand ein außergewöhnliches internationales Projekt im Rahmen des Förderprogramms „Perspektive Donau“der Stiftung Baden-Württemberg statt, an dem rund zwanzig junge Menschen im Alter von 15 bis 30 Jahren aus verschiedenen Ländern teilnahmen. Dank KuBIK e.V. - Verein zur Förderung von Kultur, Bildung, Integration und Kunst, erhielten die Teilnehmer die Möglichkeit, eine Woche lang in Österreich und der Slowakei in die Welt von Kunst, Kultur und Politik einzutauchen.
Ermöglicht wurde dies durch die Umsetzung der dritten Phase des sogenannten Donauprojekts des Vereins KuBIK, das im Rahmen des Förderprogramms „Perspektive Donau“ von der Baden-Württemberg Stiftung finanziert wurde. Die Organisation KuBIK e.V. arbeitet bereits seit mehreren Jahren mit Partnern aus Deutschland, Ungarn, Kroatien und Rumänien daran, die Jugend des Donauraums aktiv in das gesellschaftliche Leben einzubeziehen.
Schon der Name des Projekts ist von tiefgreifender Symbolik: Die Donau ist nach der Wolga der zweitgrößte und wichtigste Fluss Europas, der durch mehrere Hauptstädte der EU fließt – ein Sinnbild für die lebendige, kreative Energie der jungen Generation.
„Ziel unseres Projekts ist es, jungen Menschen die Möglichkeit zu geben, sich mit dem Schaffen von Künstlern und gesellschaftlich engagierten Persönlichkeiten auseinanderzusetzen, die unter diktatorischen Regimen in Österreich, Deutschland, Rumänien, Ungarn und auch in der ehemaligen Sowjetunion tätig waren“, erklärt Katharina Martin-Virolainen, Journalistin, Autorin und Leiterin des Projekts. „Wir haben ein spannendes Programm mit zahlreichen Workshops und Exkursionen vorbereitet, damit die Teilnehmenden verschiedene Medienformate ausprobieren können.“
Der zweite Projektleiter, Oleg von Riesen, der früher in Kasachstan lebte, ergänzt: „Wichtig ist vor allem, sich mit der Geschichte unserer Vorfahren zu beschäftigen und sich selbst besser zu verstehen – denn ohne Vergangenheit gibt es keine Zukunft.“
Aus mehreren Ländern, darunter auch aus den GUS-Staaten, wurden zwanzig glückliche Teilnehmer ausgewählt. Darunter nicht nur aktive Jugendliche des Vereins KuBIK aus Baden-Württemberg, sondern auch junge Menschen aus Temeswar in Rumänien und Budaörs in Ungarn sowie von der Berliner Sprach- und Integrationsgemeinschaft Riwwel. Untergebracht waren alle im Hotel „Ibercity Wien Schönbrunn“, unweit der berühmten kaiserlichen Residenz der Habsburger. Das Schloss Schönbrunn, ein Juwel des österreichischen Barocks, gilt als eines der prachtvollsten Schloss- und Parkensembles Europas.


Tag eins: Die Stadt der Walzer und des Kaffees
Der erste Tag des Projekts begann mit einem Kennenlernen, einer Einführung in das Projektthema sowie einem Workshop zu kreativen und innovativen Formaten. Die Teilnehmenden sollten ihre Assoziationen äußern, als sie das Bild einer Ballerina sahen. Auf den ersten Blick schien das Motiv nur positive Gefühle hervorzurufen – doch bald zeigte sich, dass Kunst auch eine dunkle Seite haben kann.
Viele waren überrascht zu erfahren, dass Kultur in der Geschichte auch für politische Zwecke missbraucht wurde – etwa in Diktaturen, wo sie als Werkzeug der Propaganda und Massenmanipulation diente.
Gleichzeitig kann Kultur auch Ausdruck des Protests oder ein Fluchtweg aus der Realität sein. Als Beispiel erzählte Katharina Martin-Virolainen von ihrer Kurzgeschichte „Warlams Geliebte“, in der ein Künstler während der stalinistischen Repressionen versucht, den Schrecken des Alltags im Lager zu entkommen, indem er sich auf die Farben der Natur konzentriert.
Im Anschluss stand eine historische Stadtralley durch Wien auf dem Programm – ein spannendes Quiz, bei dem die Gruppen zwölf bedeutende Orte im Zentrum der Hauptstadt besuchen und dabei kreative Aufgaben lösen mussten. Eine davon: die Liebe fotografieren. Manche entdeckten sie in einem Händchen haltenden Paar, andere im Herzsymbol einer Ampel oder in kunstvollen Schaufensterdekorationen. Ebenso wurden „lebende Skulpturen“ nachgestellt und Szenen aus dem Wiener Straßenleben eingefangen – Straßenmusiker, Maler, Fiaker und moderne Busse nebeneinander als Sinnbild für Tradition und Gegenwart.
„Wien ist eine unglaublich schöne Stadt – trotz Regen und Wind erinnert sie mich an mein heimisches Sankt Petersburg“, erzählte der Teilnehmer Ivan Kavchenko. „Prächtige Architektur, freundliche Gesichter, eine große Flusslandschaft – hier ist es die Donau, dort die Newa – und überall der Duft von Kaffee und eine besondere Atmosphäre von Kunst und Kreativität.“
Ich erinnerte außerdem an eine bemerkenswerte historische Verbindung: „In Ostkasachstan, das man wegen seiner unberührten Natur oft das zweite Schweiz nennt, gibt es hoch in den Bergen des Altai die Alte Österreichische Straße. Sie wurde während des Ersten Weltkriegs von gefangenen Soldaten der Österreich-Ungarischen Monarchie erbaut – unter extremen Bedingungen, und sie ist bis heute, über hundert Jahre später, in Betrieb.“
Auch die ungarischen Teilnehmer Liliana Hoffmann und András Gajdos aus Budapest teilten ihre Eindrücke. „Meine Großmutter sprach Russisch“, erzählte Gajdos mit einem Lächeln, „und sie brachte mir sogar das Sprichwort bei: ‚Wer Schlitten fahren will, muss sie auch ziehen.‘“
Wien begeisterte alle – die Stadt der großen Komponisten Mozart, Beethoven und Strauß, die Stadt der Walzer, der Musik und des Lebensgefühls. Der Multiinstrumentalist Mark Martaler, der gleich auf fünf Instrumenten spielt, brachte diese musikalische Stimmung besonders zum Ausdruck.
Das Wahrzeichen der Stadt, der Stephansdom, gilt als das wohl meistfotografierte Motiv entlang der berühmten Ringstraße, die das historische Zentrum Wiens wie ein Band umschließt.
Hier lebte und arbeitete einst der Begründer der Psychoanalyse, Sigmund Freud. Dieser Ort ist dem Spätaussiedler Evgenij Sofronow, gebürtig aus Sankt Petersburg, besonders nah.
Am Abend wurde beim gemeinsamen Abendessen in einem gemütlichen Wiener Restaurant lebhaft über die Tagesaufgaben diskutiert. Serviert wurde der Klassiker – das Wiener Schnitzel. Den legendären Sachertorte-Kuchen konnten die Teilnehmenden erst am Ende der Woche genießen – die Schlangen vor dem Café Sacher waren schlicht zu lang.


Tag zwei: Erinnerung, Verantwortung, Zukunft
Der zweite Tag führte die Gruppe in das Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands. Dort diskutierten die Teilnehmenden über das Zitat:
„Wenn Recht zu Unrecht wird, wird Widerstand zur Pflicht.“
„Für mich bedeutet das eine moralische Verpflichtung, sich gegen ein ungerechtes System oder ungerechte Gesetze zu stellen“, erklärte Paulina Martaler, deren deutsche Vorfahren aus Kasachstan und aus Wolhynien in der Ukraine stammen. „Manchmal ist aktiver Widerstand notwendig, um Gerechtigkeit und Menschenrechte zu verteidigen. Ein Beispiel dafür ist die Gruppe ‚Weiße Rose‘ im Dritten Reich, die in ihren Flugblättern zum Sturz des NS-Regimes aufrief.“
Ihr Freund Christoph Krämer aus Rumänien stimmte ihr zu. Beide verbindet ein gemeinsames Interesse am Theater, das ihnen hilft, sich selbst und ihre Werte besser zu verstehen.
Nach den Worten des Teilnehmers Steven Wagner sind Begegnungen mit der Vergangenheit entscheidend, um die Gegenwart zu verstehen und die Zukunft zu gestalten.
„Mich hat besonders das Schicksal der Schauspielerin Dorothea Neff aus dem Wiener Volkstheater bewegt“, erzählte Amely Hanke, deren Familie ebenfalls Wurzeln in Kasachstan hat. „Sie versteckte vier Jahre lang in ihrer Wohnung die jüdische Kostümbildnerin Lilli Wolff. Für diese mutige Tat erhielt sie vom Staat Israel den Titel ‚Gerechte unter den Völkern‘. Eine ähnliche Ehrung wurde der Ärztin und Widerstandskämpferin Dr. Ella Lingens zuteil, die wegen der Rettung jüdischer Flüchtlinge ins Konzentrationslager Auschwitz deportiert wurde – wo sie als Ärztin vielen Häftlingen das Leben rettete.“
Jurastudent Luca Andrei Samfira aus Rumänien betonte, wie sehr er sich freue, Teil einer so interessanten Gemeinschaft von Gleichgesinnten und Freunden zu sein.


Tag drei: Das brüderliche Bratislava
Am dritten Tag führte die Reise von Wien in die slowakische Hauptstadt Bratislava. Übrigens: Diese beiden Städte sind nicht nur Partnerstädte, sondern auch die geografisch nächsten Hauptstädte Europas – nur 55 Kilometer liegen zwischen ihnen, weniger als eine Stunde Fahrt. Bis 1936 verband die beiden sogar eine Straßenbahnlinie!
In Bratislava besuchten die Teilnehmenden das Museum der Kultur der Karpatendeutschen. Dort lernten sie die Geschichte, Kultur und Gegenwart der Karpatendeutschen kennen – einer der deutschen Minderheiten in der Slowakei – und erforschten die Beziehungen zu anderen deutschsprachigen Minderheiten in Mittel- und Osteuropa.
„Im Museum konnten wir viele authentische Exponate sehen“, berichtete Julia Gorbunov. „Der Museumsdirektor erzählte uns wenig bekannte Fakten über das Leben der Karpatendeutschen, die – wie viele andere ethnische Minderheiten – um den Erhalt ihrer Sprache, Kultur und Identität kämpfen mussten.“
Es folgte ein Treffen mit dem Museumsdirektor Rastislav Filo, mit Katrin Litschko, Chefredakteurin der Zeitschrift Karpatenblatt, sowie mit dem ifa-Kulturassistenten Yannik Baumann. Dabei wurde eine kreative Zusammenarbeit vereinbart – unter anderem sollen Berichte und literarische Texte mit Illustrationen der Teilnehmenden im Magazin veröffentlicht werden.
„Spannend war für mich vor allem, historische Parallelen in Fragen der kulturellen Identität zu ziehen“, erzählte Daria Merei. „Ich trage einen alten kasachischen Nachnamen, bin aber in Moskau geboren und aufgewachsen, wo ich mich professionell mit moderner Choreografie beschäftigt habe. Gleichzeitig bin ich Deutsche und bin im März mit meiner Familie nach Deutschland gezogen, wo ich die Schule abgeschlossen habe. Später möchte ich Modedesignerin werden.“
Das Mittagessen fand in einem außergewöhnlichen Ort statt – der Bratislavská Reštaurácia, die früher einmal ein Theater war. Serviert wurden deftige slowakische Spezialitäten: Krautsuppe mit Räucherfleisch, heimische Würste, im Ofen geschmorte Rippchen, Bryndzové Halušky mit Schafskäse und Speck, Käse-Knoblauch-Suppe im Brotlaib, süße Desserts und natürlich slowakisches Bier.
Bei der anschließenden Stadtführung beeindruckte besonders der Bratislavský hrad, die mächtige Burg auf dem Hügel mit einem atemberaubenden Blick über die Stadt und die Donau. Auch das historische Zentrum begeisterte – eine fröhliche, festliche Atmosphäre, überall Musik, Straßenkünstler, Kunsthandwerker und der Duft regionaler Küche.


Tag vier: Statt eines Nachworts
Am letzten Tag besuchten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer das Haus der Geschichte Österreichs, das mit seinen ständigen und Sonderausstellungen die Entwicklung des Landes von der Zeit des Habsburgerreichs über die Erste Republik, den Anschluss an das nationalsozialistische Deutschland, die Gründung der Zweiten Republik bis in die Gegenwart nachzeichnet.
Beim gemeinsamen Abschlussessen in einer italienischen Trattoria wurden die Erlebnisse der Woche reflektiert. Der Medienworkshop sei für viele zu einer Plattform des persönlichen Ausdrucks und der kreativen Selbstverwirklichung geworden.
Larisa und Mark Dzhabbarov zeigten sich begeistert von den Orten, den Teilnehmenden und vor allem vom inhaltlichen Tiefgang aller Begegnungen.
Auch Maria Kulikov, Projektmanagerin im soziokulturellen Bereich, die vor zweieinhalb Jahren aus der Region Jaroslawl nach Deutschland gezogen ist, zog ein nachdenkliches Fazit:
„Das Thema des Projekts regt wirklich zum Nachdenken an – nicht nur im Spiegel der eigenen Familiengeschichte, sondern im Kontext ganzer Epochen“, sagte sie. „Die Ereignisse der 1930er Jahre ähneln in mancher Hinsicht unserer Zeit. Diese Analyse hilft, die Welt als Ganzes besser zu verstehen – zu erkennen, welche Faktoren Menschen heute beeinflussen, welche Manipulationsmethoden genutzt werden, um Meinungen zu steuern, und wie man sich gegen Propaganda wehren kann.“

Text & Fotos: Elena Paschke